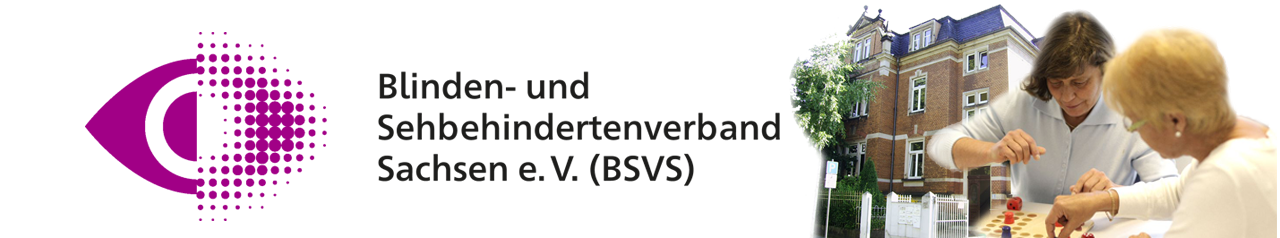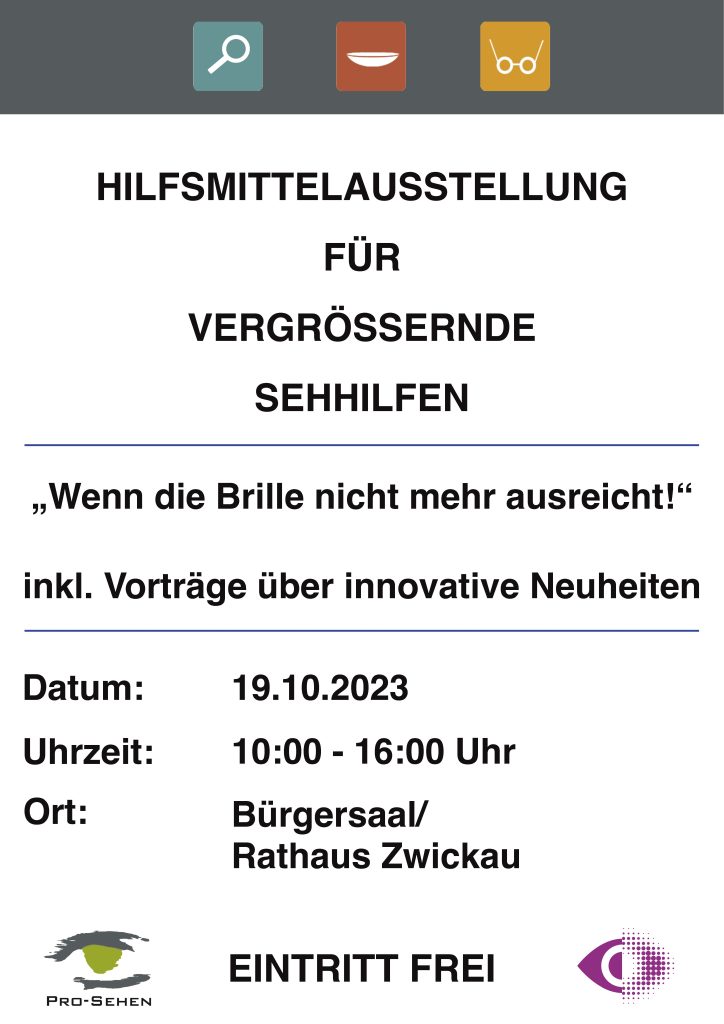Als sich die Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V., Kreisorganisation Großenhain, am 13.10.2023 und ihre benötigten Begleitpersonen zu einem Bowlingnachmittag im Schützenhaus Großenhain trafen, war der Vorstand von der Resonanz, also von der geringen Teilnehmerzahl etwas enttäuscht. Am Ende gingen alle zufrieden nach Hause, denn es hatte auch in kleiner Runde riesigen Spaß gemacht. Nicht nur einmal vielen alle Pins um.
Ich werde nach so einem Artikel immer wieder gefragt, wie macht ihr das, wenn ihr nur wenig oder gar nichts seht. Im Grunde ist es ganz einfach: Ich stelle mich dabei erst einmal breitbeinig in die Mitte der Bahn und mein Spielpartner reicht mir die Kugel. Anschließend geh ich in die Hocke und pendle mit der Kugel zwischen den Beinen vor und zurück. Mein Partner achtet auf meine Pendelbewegungen, korrigiert mich, wenn nötig und gibt das Kommando die Kugel nach vorn zu schieben. Abschließend richte ich mich wieder auf, lausche dem „Kullern“ der Kugel, achte auf das Fallen der Pins, und hoffe auf ein gutes Ergebnis! Das Entscheidende bei der ganzen Sache ist: Stets voll konzentriert zu bleiben. Vor allem muss ich versuchen so gleichmäßig und konstant wie möglich meinen Bewegungsablauf einzuhalten. Dabei reicht schon die kleinste Abweichung und die Pins bleiben stehen. Doch habe ich erst einmal den Ablauf verinnerlicht, dann funktioniert es meist ganz gut.
Ein Dank geht an dieser Stelle an Ronny und Ramona, die sich um die Organisation der Veranstaltung gekümmert haben und das Team des Schützenhauses.
Blinde und Sehbehinderte können sich sehr gern mit Ihren Fragen und Problemen an Frank Herrmann unter 0176-30454301 oder bsvs.grossenhain@gmail.com wenden.